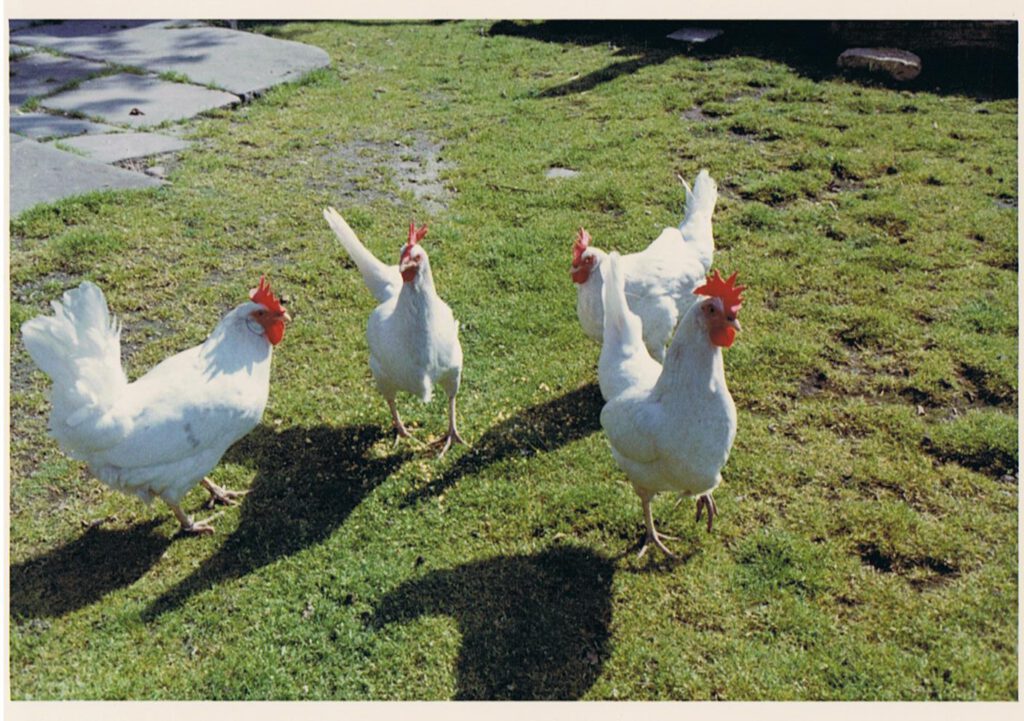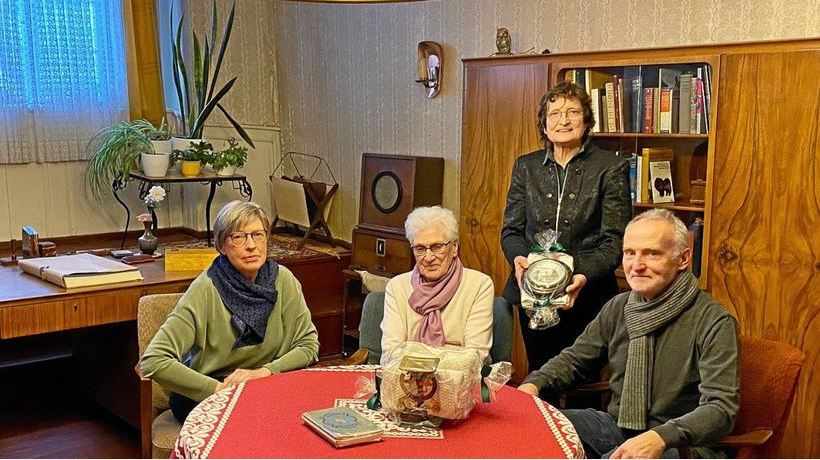Selbst die von der nahegelegenen Biogasanlage herüberwehenden Gerüche konnten den Enthusiasmus an der Sassenburg nicht stoppen – das lag an den neu aufgedeckten Bodenstrukturen und tollen Funden.
Der Tag begann mittlerweile routinemäßig mit ausgiebigen Dokumentationsarbeiten, bevor im Nordschnitt bereits mit dem fünften Planum an der Wallgruppe begonnen wurde. Immer deutlicher zeichnet sich hier die verkohlte Wallkonstruktion ab. Ein größeres Stück Holz scheint genügend Jahrringe aufzuweisen, um es exakt datieren zu können.


Weitere interessante Erkenntnisse wurden auch im östlichen Abschnitt der Grabung gesichert. Ein Highlight war das gut erhaltene Stück eines Wetzsteines, der an mehreren Seiten Schleifspuren aufweist. Etwas weiter innerhalb des östlichen Abschnittes zeichnen sich die offenbar wallparallelen Balken und die stabilisierenden Querbalken immer deutlicher ab. Spannend sind außerdem die Reste von ehemaligen Pfosten, die vermutlich dazu gedient haben, den inneren Wallaufbau abzustützen.
Im Inneren der Sassenburg begannen heute zudem die Untersuchungen in einem großen, insgesamt 100 Quadratmeter großen Grabungsschnitt. Schon kurz unter der Oberfläche konnte mehrere unterschiedliche mittelalterliche Keramikfragmente freigelegt werden. Einige der Scherben könnten zu einem einzigen Gefäß gehören. Diese Funde werden durch einige vereinzelte, aber gut erhaltene Silex-Fragmente ergänzt.


Diese zahlreichen Funde und Befunde spornen dazu an, weiter in die Tiefe vorzudringen – auch wenn das zunächst bedeutet: Schaufeln, schaufeln, schaufeln!